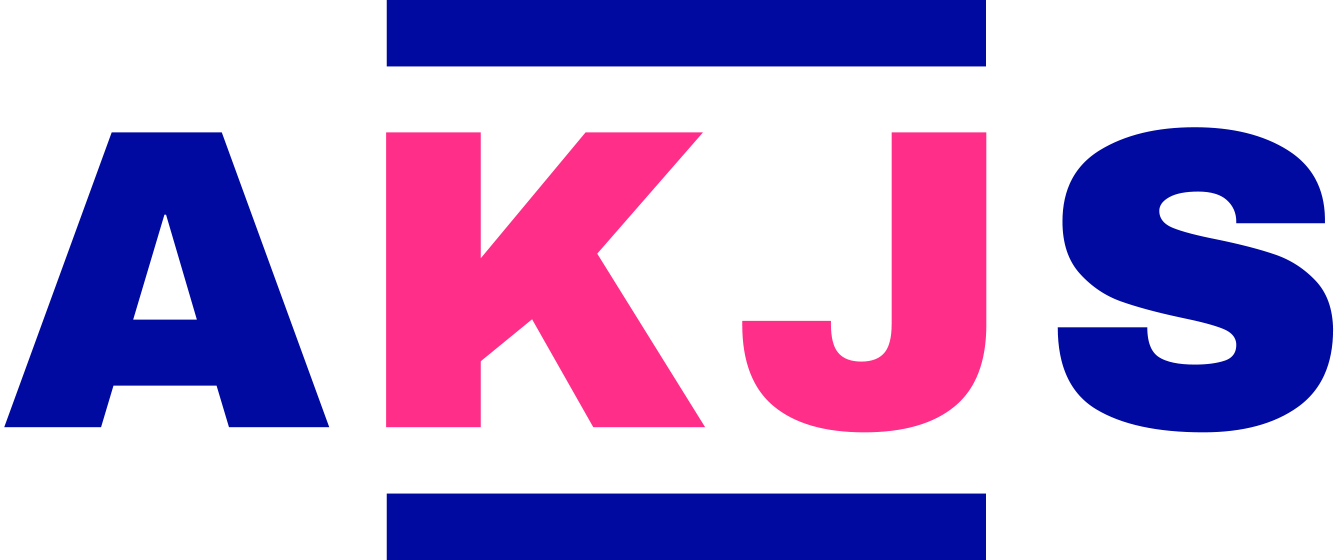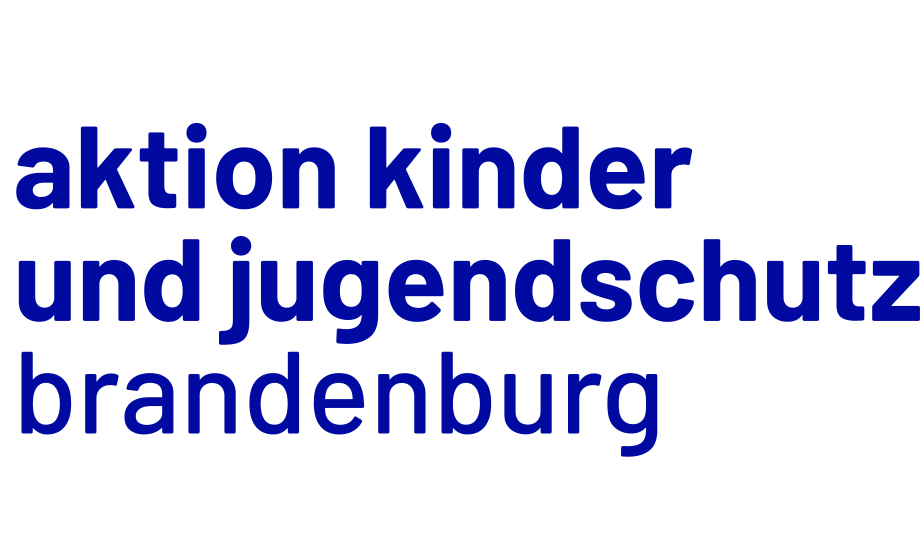BESCHREIBUNG
Unter Hass im Netz wird diskriminierendes Verhalten im digitalen Raum verstanden. Dabei erfahren Menschen Ausgrenzung und Abwertung aufgrund ihres Geschlechts, ihrer sexuellen Orientierung, ihrer Religion, ihrer vermeintlichen Herkunft oder ihres Körpers. Auch wenn sie sich gegen Diskriminierung einsetzen oder politisch engagieren, können sie betroffen sein.
Hass im Netz trifft also nicht alle gleichermaßen. Er basiert auf bestehenden Macht- und Diskriminierungsstrukturen aus der analogen Welt und kann sich in Form von verbalen Beleidigungen, Drohungen, sowie beleidigenden Bildern oder Videos äußern. In manchen Fällen ist Hass im Netz auch strafbar, wenn er gegen bestimmte Rechtsnormen verstößt, wie zum Beispiel Volksverhetzung (§ 130 StGB), Üble Nachrede (§ 186 StGB), Verleumdung (§ 187 StGB) oder Beleidigung (§ 185 StGB).
Viele Betroffene ziehen sich aufgrund solcher Erfahrungen von bestimmten Plattformen zurück, da das für sie oft der einzige Weg ist, dem Hass zu entkommen. Das hat leider zur Folge, dass die Vielfalt im Internet abnimmt.
UMGANG
Intervention:
- behutsam mit betroffenen Kindern und Jugendlichen sprechen, ihnen zuhören
- Betroffene ernst nehmen, sie schützen und stärken: Diskriminierungserfahrungen finden häufig auf mehreren Ebenen statt (interpersonell, institutionell, gesellschaftlich) und meist machen Betroffene schon jahrelang Erfahrungen mit Diskriminierung. Das bedeutet, dass sie „Expert:innen“ sind und gleichzeitig häufig mehrfach betroffen. Hier gilt es, ihere Erfahrungen auf keinen Fall zu bagatellisieren.
- nicht gleich aufgeben, wenn Betroffene die Hilfe ablehnen. Häufig ist Angst vor der Peer-Group oder den Eltern im Spiel; Oder sie wollen sich keine Blöße geben vor einer Person, die womöglich diese Erfahrungen (z.B. von Rassismus) nicht selbst kennt
- Schauen, wie es der betroffenen Person geht und was für sie getan werden kann; herausfinden, ob Selbst- oder Fremdgefährdung im Raum steht.
- kein Smartphone-Verbot für Betroffene, eher Empfehlung für smartphonefreie Zeit, um wieder zu Kräften zu kommen
- Bystander gewinnen für Solidarisierung mit den Betroffenen (z.B. Unterstützendes posten)
- gemeinsam mit Betroffenen über die nächsten Schritte sprechen
- sich ggf. Beratung und Unterstützung holen, wenn möglich bei Einrichtungen oder Personen, die vertraut sind mit dieser Art von Diskriminierung
- Beweise sammeln (rechtssichere Screenshots erstellen) und sichern
- Hater:innen blockieren
- Anzeigen und Melden bei Dienstanbieter
- ggf. an die Polizei wenden und Anzeige erstatten
Interventionsmaßnahmen immer in Absprache mit den Betroffenen – außer bei gravierenden Fällen, bei denen jedoch Interventionsschritte im Vorhinein den Betroffenen gegenüber transparent gemacht werden.
Prävention:
- Werterahmen schaffen: gegenseitiger Respekt, Anerkennung von Differenz/Verschiedenheiten als gleichwertig
- Sensibilisierung für Diskriminierung (im Netz)
- Sensibilisierung für unterschiedliche Erfahrungen, für Benachteiligungen und Privilegien und dafür, dass manche mehr Diskriminierung erfahren als andere
- Kinder und Jugendliche stärken in Solidarität und Empathie
- Ressourcen für ein gutes und vertrauensvolles Gruppenklima stärken
- Partizipation ermöglichen
- über Risiken von Hass im Netz aufklären
- über Gewalt, Rechte und Rechtliches informieren
- klare Haltung zeigen
- im offenen Gespräch mit den Kindern und Jugendlichen bleiben, sich für sie interessieren
- Angebote von Formaten Politischer Bildung (z.B. mithilfe von Methoden gegen Hass im Netz)
- auf Hilfs- und Beratungsangebote aufmerksam machen
- Regeln vereinbaren (Nettiquette entwickeln, z.B. für Gruppenchats)
BERATUNG UND UNTERSTÜTZUNG
Offizielle Beschwerdestellen:
Internet Beschwerdestelle: Volksverhetzende Inhalte / Jugendschutz im Netz
Beratung / Unterstützung:
HateAid: Beratung für Betroffene digitaler Gewalt
insta: @hateaid
Das Nettz: Vernetzungsstelle gegen Hate Speech
Love-Storm: Materialien und Infos rund um Hass im Netz
Klicksafe: Infos und Materialien zur Förderung von Online-Kompetenz von jungen Menschen
…explizit für junge Menschen:
juuupoort: Peer-to-Peer-Beratung bei Cybermobbing und anderen Online-Problemen
Handysektor: Infos und Unterstützung im Netz für Jugendliche
LITERATUR UND MATERIALIEN
Das NETTZ, Gesellschaft für Medienpädagogik und Kommunikationskultur, HateAid und Neue deutsche Medienmacher*innen als Teil des Kompetenznetzwerks gegen Hass im Netz (Hrsg.) (2024): Lauter Hass – leiser Rückzug. Wie Hass im Netz den demokratischen Diskurs bedroht. Ergebnisse einer repräsentativen Befragung. Berlin.
Daniel Geschke, Anja Klaßen, Matthias Quent, Christoph Richter: #Hass im Netz: Der schleichende Angriff auf unsere Demokratie. Eine bundesweite repräsentative Untersuchung. Jena.
Klicksafe: Hassrede im Netz. Von den Grenzen der Meinungsfreiheit. Informationen für pädagogische Fachkräfte.
toneshift: Welche Auswirkungen hat Hass im Netz?
Materialien:
HateAid: Rechtssichere Screenshots erstellen – wie geht das?
Saferinternet.at: Hass im Netz kontern (Unterrichtsmaterial)
Gesellschaft für Medienpädagogik und Kommunikationskultur (GMK):
- Fachkräftequalifizierung gegen Hass im Netz
- Methoden für die politische Medienbildung gegen Hass im Netz
scroll nicht weg: Digitale Zivilcourage gegen hatespeech
Love-Storm:
Plakat „Was tun bei Konflikten im Gruppenchat?“
10 Tipps gegen Hass im Netz
Plakat „Hass stoppen“